Robert Axelrod: Die Evolution der Kooperation
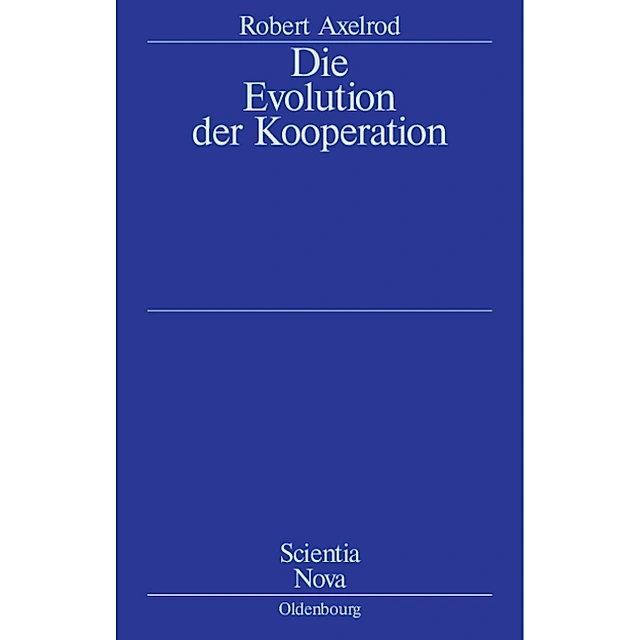
Wenn von Kooperation oder Zusammenarbeit der Rede ist, sind meistens Worte wie “Vertrauen”, “Gemeinschaft’” und „Solidarität“ nicht fern. Kooperatives Verhalten setzt – so denkt man – ein gewisses Vertrauen in die Person oder Struktur voraus, mit der man kooperieren möchte. Meistens begegnet man in der Diskussion um kooperatives Verhalten deshalb oft normativen Ansprüchen und moralischen Appellen. Von „Massnahmen zur Vertrauensbildung“ ist da die Rede, es geht um vertragliche oder informelle Verpflichtungen zur Zusammenarbeit, oder es werden psychologische oder sozialtherapeuttische Kriterien wie „Persönlichkeit“ oder „Charakter“ herangezogen, um Kooperativität zu erklären, oder Kooperation soll mit ehr oder minder ausgeprägtem Zwang durchgesetzt werden. Die auf der mathematischen Spieltheorie basierende Theorie des rational choise liefert dazu einen anderen Ansatz, für den Robert Axelrod berühmt geworden ist.
Moralische Konflikte eskalieren oft mit der Folge, daß entsprechende negative Sanktionskreisläufe entstehen. Dann ist es mit dem geforderten kooperativen Verhalten eben doch nicht so, wie der Plan es erfordert. Denn wir leben in einer kompetitiven Umwelt, die egoistisches Verhalten belohnt, egal wie sehr auch Vertrauen gefordert sein mag. In der Praxis müssen wir täglich mit solchen Widersprüchen klarkommen. Einerseits ist kooperatives Verhalten ja kaum zu erzwingen, denn Kooperation setzt immer eine gewisse Freiwilligkeit voraus. Andererseits ist die Frage, ob und wie Menschen miteinander kooperieren, zwar durchaus auch eine Frage sozialer Regeln und Normen, was aber immer wieder auch von taktischen Überlegungen geprägt ist. Denn ist der Praxis ist Kooperation etwas, was auch ohne übergreifende Normen und Zwänge immer wieder „einfach so geschieht“.
Wie erforscht man die Bedingungen solcher scheinbar spontan entstehenden Kooperationsbeziehungen, ohne sich in den Sumpf psychologischer, moralischer, juristischer oder gar religiöser Bewertungsmuster zu begeben?
Eine sozioloigsche Frage – denn ohne tragfähige soziale oder wirtschaftliche Beziehungen, d.h. ganz ohne, Vertrauen, Bindung und sozialen Zusammenhalt scheint kooperatives Verhalten kaum denkbar zu sein. Einen interessanten – weil eben nicht normativen – Ansatz zur Erforschung von kooperativem Verhalten (und wie es entsteht) verfolgte Robert Axelrod mit einem sozialpsychologischen Forschungsansatz, der nicht normativ ist, sondern experimentell. Axelrod griff auf das aus der Sozialpsychologie bekannte „Gefangenendilemma“ und die mathematische Spieltheorie zurück, und erforschte mit deren Hilfe verschiedene Spielstrategien. Es gelingt ihm eine Begründung, nach der sich kooperatives Verhalten durchaus auch als rational begründbar verstehen läßt.
In einem von Axelrod veranstalteten Computerspiel-Turnier trug interessanterweise immer wieder die ganz einfache Strategie namens „TIT FOR TAT“ (dt.: Wie Du mir so ich Dir“) den Sieg davon, ersonnen von dem bekannten Konfliktforscher Anatol Rapoport. Dieses Ergebnis lieferte den Befund, um den das Buch „Evolution der Kooperation“ inhaltlich kreist.
Zu diesem Thama fand im Mittelpunkt auf Einladung der Regionalgruppe Berlin im Berufsverband Soziologen am 18. Juli 2010 ab 19:30 in der Buchhandlung „Der Zauberberg“ in Berlin Friedenau statt, auf dem ich refertierte. Als Soziologe stellte ich den Forschungsansatz Axelrods vor und stellte ihn anderen normativen Kofliktmodellen gegenüber Im Mittelpunkt der kontroversen Diskussion stand u.a. die Frage, ob es möglich ist, Ergebnisse solch experimenteller Forschungen produktiv für die eigene Arbeit zu nutzen. Insbesondere auch, ob der Ansatz dazu dienen kann, die eigene Arbeit im Bereich Training oder Beratung sozialwissenschaftlich zu begründen.
Es gab eine eine spannende Diskussion, die einen weiten Spannungsbogen aufzeigte zwischen intellektueller Faszination einerseits und großer Skepsis der Teilnehmer, was alltagspraktische Relevanz dieser Forschung angeht. Offenbar bestand eine große Neigung, sich lieber auf konventionelle und moralische Erklärungsmuster zu verlassen, wenn es um Vertrauen und Kooperation geht. Grund genug, sich weiter mit dem Thema zu befassen.
Weitere Informationen:
Das Buch ist in der 7. Auflage in einer Studienausgabe (Oldenbourg 2009, ISBN 348659172) erhältlich, Robert Axelrods Homepage an der University of Michigan: http://www-personal.umich.edu/~axe/
Wer sich intensiver mit der Spieltheorie auseinandersetzen möchte, sei auf Professor Riecks Spieltheorie-Seiten verwiesen: http://www.spieltheorie.de/index.htm. Eine hervorragende Rezension zu dem Buch findet sich übrigens auf Winfried Berners „Umsetzungsberatuung“.

